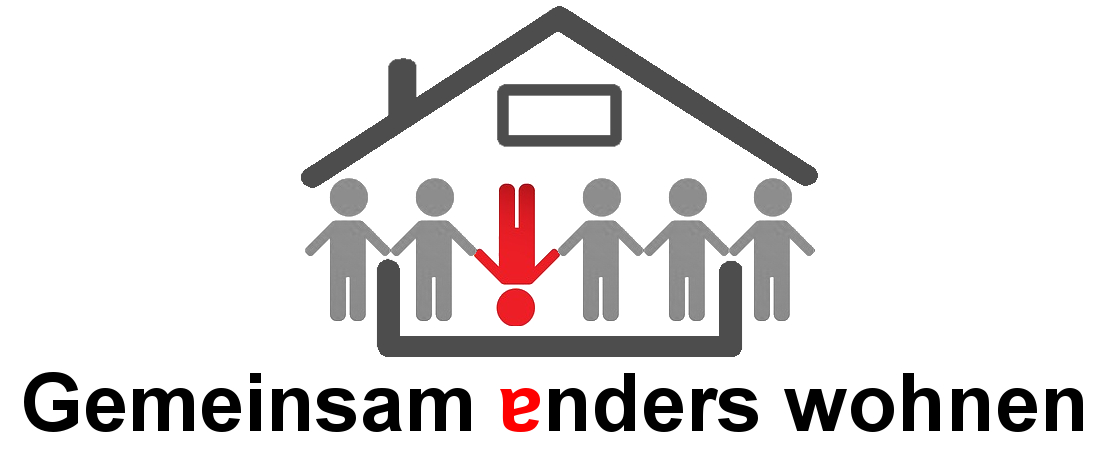Es geht auch anders
Alternative Wohnkonzepte
Mikro-Apartment, Mehrgenerationenhaus, Genossenschaften – alternative Ansätze mischen den Mietmarkt auf. Sie sind die kreative Antwort auf die immer schwierigere Wohnungssituation in Großstädten
von Andrea Hoffmann-Topp
Alle Wege von der Eingangstür sind kurz: zwei Schritte zum Klo, drei zum Bett, vier zur Küche. Willkommen im Mikro-Apartment. Auf 20 bis 40 Quadratmetern schaffen Architekten wahre Platzwunder. So wie in der Schwabinger Anlage, in der Student Daniel wohnt. Es gibt Dusche, Toilette, Hochbett, Kochstelle und klare Regeln: Nägel in die Wand schlagen ist verboten; Bilder kommen an die Galerieschiene. Alles hat hier seinen festen Platz.
In Schwarmstädten wie München, die unter chronischem Wohnungs- und Platzmangel leiden, sind solche vollmöblierten Komplettpakete zu einem Erfolgsmodell geworden. Kein Wunder: Die Zahl der Alleinwohnenden steigt, in München machen sie bereits 54 Prozent aller Haushalte aus. Mikro-Apartments sind aber nur eine von vielen alternativen Wohnkonzepten, mit denen Stadtplaner, Architekten, Baugesellschaften und Bürger auf mangelnden Platz und steigende Preise reagieren. Einige Ideen muten extrem an: In Hamburg etwa leben manche inzwischen in schwimmenden Luxushäusern in Hafennähe, während ein schwedisches Start-up kleine Wohnwagons entwickelt hat, deren Bewohner dank Solarpaneelen, Wassertank und Dachgemüsegarten nicht nur überall, sondern auch autark wohnen können.
Von derart unkonventionellen Bauformen ist Sebastian Oppermann weit entfernt, aber auch ihm geht es um anderes Wohnen, genauer: um „Gemeinsam anders wohnen“. Diesen Namen trägt eine Bürgerinitiative, die er 2017 als Stammtisch ins Leben gerufen hat, um in Holzkirchen ein genossenschaftliches Wohnprojekt zu realisieren. „6000 Euro pro Quadratmeter für eine Eigentumswohnung sind auch im Umland von München keine Seltenheit mehr“, weiß Oppermann aus eigener Erfahrung. Die einzige Chance für Normalverdiener, etwas Eigenes zu kaufen, sei die Abkopplung vorn Markt. „Dieser regelt sich leider nur in eine Richtung selbst — nämlich nach oben“‚ sagt Oppermann, der den genossenschaftlichen Wohnungsbau für die beste Antwort auf diese Misere hält.
Wer sich seinem Modell anschließt, zahlt eine Einlage in die Genossenschaft und erhält im Gegenzug lebenslanges Wohnrecht. Nach Oppermanns Planungen würde der einmalige Pflichtanteil für eine Zweizimmerwohnung mit 50 Quadratmetern bei 25OOO Euro liegen, zahlbar in Teilraten gemäß Baufortschritt. Nach Einzug läge die Kaltmiete für einen Neubau bei moderaten zehn Euro pro Quadratmeter.
„Sicher wie Eigentum – flexibel wie Miete“: Auf diese simple Formel bringen Befürworter die Vorteile genossenschaftlichen Wohnens. Jedes Genossenschaftsmitglied ist Teil der Eigentümergemeinschaft und muss weder Kündigung noch Mieterhöhung nach Weiterverkauf fürchten. Das lebenslange Wohnrecht erlischt nur, wenn das Mitglied wegzieht – dafür gibt es dann die anfangs gezahlte Einlage zurück.
Dieses Modell ist zwar nicht neu, doch in Zeiten rapide ansteigender Miet- und Kaufpreise zunehmend attraktiv — und damit Antrieb für Initiativen wie die von Sebastian Oppermann. Insgesamt werden deutschlandweit derzeit rund 2,2 Millionen Wohnungen von Genossenschaften verwaltet, in ihnen leben fünf Millionen Menschen. Wer sich auf ein genossenschaftliches Wohnprojekt einlässt, sollte sich aber auch darüber im Klaren sein, dass das soziale Miteinander und auch die materielle Teilhabe im Vordergrund stehen. Bei Oppermanns Modell bedeutet das im Alltag: Alle Mitglieder teilen sich Werkstatt, Gästezimmer, Rasenmäher und Bohrmaschine. Mitbestimmt wird, wenn es um projektbezogene Themen wie Gebäudeeinrichtungen und das Zusammenleben der Gemeinschaft geht. Unabhängig von der Größe seiner Wohnung hat jeder Eigentümer das gleiche Stimmrecht und bringt sich aktiv in AGs ein, die die Hausverwaltung regeln, sich über Ausstattung von Gemeinschaftsräumen Gedanken machen und nachbarschaftliche Hilfe organisieren. Das Ziel? „Die robuste Hausgemeinschaft“‚ wünscht sich Oppermann.
So etwas hat Rudi, 79, für sich bereits gefunden: Er lebt im Südwesten Münchens in der Wohngemeinschaft seiner Träume und ist dort Märchenonkel für sechs Kinder im Vorschulalter. „Ein Job, den ich nicht mehr missen möchte.“ Vor vier Jahren hat sich Rudi entschlossen, in ein Mehrgenerationenhaus einzuziehen. „Nachdem meine Frau gestorben war und wir keine Kinder haben, wollte ich nicht einsam in unserem Haus bleiben.“ Inzwischen bewohnt er eine 70 Quadratmeter große Erdgeschosswohnung mit Terrasse und Blick auf Gemeinschaftshäuser und -gärten. In der Tageszeitung hatte er von dem neuen Wohnkonzept erfahren, das ihn schnell überzeugte. „Hier ist immer was los. Es erinnert mich an das Leben in Großfamilien, nach dem ich mich immer gesehnt hatte. Einsamkeit kenne ich hier nicht, aber es gibt auch Rückzugsorte, wenn ich allein sein will.“
„Der Wohnungsmarkt regelt sich leider nur in eine Richtung selbst – nach oben«
Die Leitidee der bundesweit mehr als 540 Mehrgenerationenhäuser liegt im sozialen und nachbarschaftlichen Miteinander und im aktiven Austausch der Altersgruppen: Rudi liest vor, die Kinder bringen am Samstag die Frühstückssemmeln, ihre Eltern begleiten Rudi bei Behördengängen oder übernehmen den Fahrdienst zum Arzt. Grundsätzlich kann jeder in einem Mehrgenerationenhaus leben, der sich in der Gemeinschaft kontinuierlich und verantwortlich engagiert. Gegenseitige Hilfe ist schließlich der Kerngedanke des Konzepts. Und: In einem Mehrgenerationenhaus treffen viele Menschen mit unterschiedlichsten Lebensgeschichten aufeinander. „Da kracht es schon mal kräftig“‚ schmunzelt Rudi. Kein Problem, wenn Konflikte gleich bewältigt werden. Damit das gelingt, ist soziale Kompetenz ein Kriterium bei der Vergabe der begehrten Wohnungen.
Der Gemeinschaftsgedanke spielt auch in Daniels Mikro-Apartment—Anlage eine Rolle, allerdings geht es eher um Spaß als um gegenseitige Hilfe. Services wie ein hauseigenes Fitnessstudio, eine gemeinsame Dachterrasse oder eine TV Lounge klingen mitunter nach Hotel. „So fühlt es sich auch an“, sagt Daniel, als er abends von der Uni kommt und vom Community-Manager in der Lounge begrüßt wird. Schnell noch ein Blick auf die hauseigene App, was am Abend hier im Gebäude vor sich geht: Kochkurs oder Studentenparty? Wer vernetzt ist, empfindet die eigenen vier Wände nicht mehr ganz so klein. Fehlt denn überhaupt nichts? „Ich wohne in der sechsten Etage ohne Balkon. Der Weg an die frische Luft ist also ziemlich weit. Ansonsten habe ich mich gut sortiert“, sagt Daniel, der zum Masterstudium im Sommer nach Berlin zieht – wieder in ein Mikro-Apartment.
[Süddeutsche Zeitung, 26.06.2018]