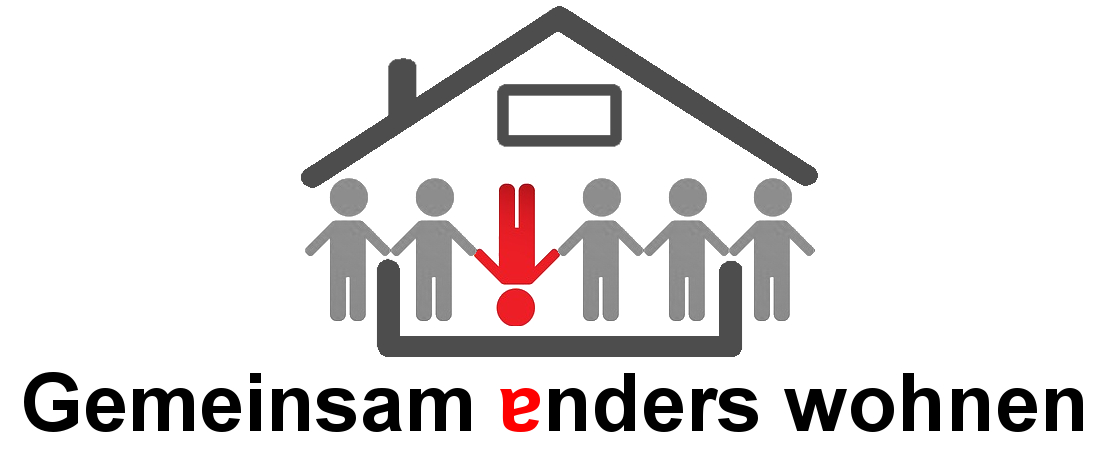Generationen unter ein Dach bringen
Ein Wohnprojekt, in dem mehrere Generationen unter einem Dach leben. Am besten zentral im Ort gelegen, damit fußläufig alles erreichbar ist. Das kann sich die SPD-Kreisrätin Christine Negele auch für Tegernsee vorstellen. Im Stadtrat stellte sie ihre Idee jetzt vor und stieß grundsätzlich auf offene Ohren.
Tegernsee – In einer lebendigen Generationen-Gemeinschaft bezahlbar wohnen: Davon träumt Christine Negele (63) nicht nur. Schon vor Corona hatte die SPD-Kreisrätin aus Tegernsee ihre Initiative für „ein bezahlbares nachbarschaftliches Wohnen einheimischer Bürger*innen am Tegernsee“ gestartet. Es gab erste Treffen, dann bremste Corona das Projekt zwei Jahre lang aus. Jetzt stellte Negele ihre Idee eines Wohnprojekts, realisierbar über eine Genossenschaft oder als kommunaler Bau, im Tegernseer Stadtrat vor.
Dort kam der Gedanke eines Mehrgenerationenhauses mit echter Gemeinschaft gut an. „Das sollten wir auf dem Schirm haben“, meinte Bürgermeister Johannes Hagn (CSU) nach Negeles Vortrag. Schließlich gebe es einige Objekte, die die Stadt in der Zukunft entwickeln wolle. Gedacht ist zum Beispiel ans Bahnhofsareal, möglicherweise auch ans Horn-Grundstück.
Wie ein solches Wohnprojekt aussehen kann, hat sich Negele vielerorts angeschaut. Auf ihrer Liste möglicher Kooperationspartner steht die Genossenschaft MARO mit Sitz in Ohlstadt im Landkreis Garmisch-Partenkirchen weit oben. Negele ist auch nicht allein. Zu den ersten Treffen ihrer Initiative 2019 kamen rund 50 Interessierte. Manche haben sich inzwischen verabschiedet, weil zu lange nichts realisiert werden konnte. Anderen gefiel nicht, dass kein Eigentum geschaffen wird, sondern Mietwohnungen. Auch die Vorgabe, dass ein echtes Miteinander gelebt werden soll, behagt nicht jedem. Trotzdem dürfte es keinen Mangel an Menschen geben, die gern in ein Generationenhaus ziehen wollen. Negele selbst gehört dazu. „Ich mache das auch für mich“, ließ sie wissen. Ihre Initiative präsentiere sie nicht als SPD-Politikerin, sondern als Tegernseer Bürgerin.
Negele hat sich schon so lange mit dem Thema befasst, dass sie auch die Schwachstellen kennt. „Wichtig ist, dass es von Anfang an einen echten Generationen-Mix gibt“, erklärte sie. Nur so kann das Prinzip Babysitten gegen Hilfe beim Einkauf dauerhaft funktionieren. Ziehen nur Mieter im Rentenalter ein, überaltert die Wohngemeinschaft mit den Jahren, Junge kommen nicht mehr dazu. „Daran sind schon einige Projekte eingegangen“, weiß Negele.
Um zu funktionieren, sollten zum Generationen-Projekt mindestens acht bis zwölf Wohnungen gehören, am besten mit fußläufiger Verbindung zur Ortsmitte. Sie bieten gerade so viel Platz, wie die Bewohner brauchen. Für größere Tischrunden gibt’s einen Gemeinschaftsraum, für Besuch ein Gästezimmer, das nach Absprache alle Bewohner nutzen können.
Für Stadtrat Thomas Mandl (SPD) ist das Modell „wahnsinnig interessant“. Für die Stadt sei es doch „fast erotisch“, wenn sie Häuser nicht nur kaufe, sondern daraus auch ein solches Zuhause gestalte, meinte Mandl. Auch Ursula Janssen (Grüne) signalisierte Unterstützung: „Wir sollten bei der Überplanung des Bahnhofsareals in diese Richtung denken.“
[Merkur, 12.04.2022]